|
Kerekes Gábor, Budapest | 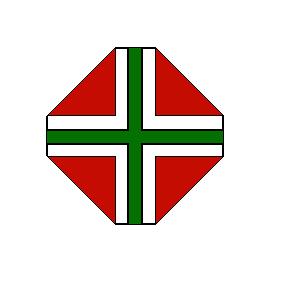 |
|
Märznacht und Aprilmorgen „Jetzt haben sie mich!“, dachte der Junge erschrocken und hastete in der
Dunkelheit weiter durch die Straßen des Ortes. Hinter sich hörte er schwere
Stiefeltritte. Er wich seinen Verfolgern geschmeidig aus, der eine von ihnen,
der Stämmige, rutschte aus und fiel der Länge nach hin. Der Junge kicherte beinahe
unbeschwert, als er das sah, wurde unaufmerksam und blieb dann an einem
herausstehenden Nagel des Holzzaunes hängen, an dem er gerade entlanglief – die
Stiefelhose riss, und kaum dass das trockene Geräusch des reißenden Stoffes
verklungen war, spürte er den Schmerz in seinem Oberschenkel. Doch er musste weiter! Kreuz und quer war er schon durch die Gassen gerannt, über Zäune gestiegen
und durch Gärten geeilt, dabei mehrmals den Gendarmen beinahe in die Arme
gelaufen. Verärgert hatten sie versucht, ihn zu fangen, vor der Bäckerei Fath wäre es ihnen beinahe gelungen, doch sie waren
langsam, einige nicht einmal von hier, so dass er ihnen schließlich immer
wieder entkommen war. Die fremden Gendarmen waren offensichtlich zur
Verstärkung als Wache am Zug geholt worden. Geduckt lief er jetzt in der Kalvariengoosn unter
den erleuchteten Fenstern der Gastwirtschaft Brader
in den Schatten. Er lief weiter und lief und lief. Er wusste nur eines ganz
genau: er würde nicht mit dem Zug wegfahren. Nicht weg von hier, wo seine
Eltern ihr Grab hatten. Er würde bleiben. Er war ein Kind, und doch schon
erwachsen. Er sah sich um und lief im Zickzack mehrmals über die Wiener Goosn, bis das Geräusch der ihm nacheilenden Schritte leiser
zu werden schien. Es war auch höchste Zeit: er war schon ganz außer Atem. Schnell versteckte
er sich im Schatten. Er würde die Pilischgegend nie verlassen. Sein
Vater, ein wortkarger Mann, hatte ihm die Liebe zur Heimat fast ohne Worte,
allein durch seinen eigenen Lebensweg vermittelt. Nie sagte er zu seinem Sohn,
einem späten Kind: „Martin, hier ist unsere Heimat!“ Doch warum war der Vater
einst aus Amerika nach nur wenigen Jahren gerade hierher zurückgekehrt, wenn
nicht deshalb, weil er hier die wirkliche Heimat wusste? Da! Ein trockener Ast knackte irgendwo rechts im Dunkel. Eine kalte Hand legte
sich um Martins Herz. Er hielt angestrengt den Atem an und lauschte, doch zum
Glück kam da niemand. Wahrscheinlich eine Katze, dachte er. Doch hier konnte er
nicht bleiben, sie würden ihn auf der Straße bald finden. Vorsichtig schlug er
den Weg zum Friedhof ein. Abwartend bewegte er sich dabei von einer dunklen
Stelle zur anderen, um möglichst nicht gesehen zu werden. Er wagte es nicht, den
Friedhof von vorne zu betreten, da hätte man ihn leicht sehen können, sondern
er schlich sich vorsichtig von der Seite ein. Wenn sie nicht wüssten, dass er
hier ist, würde er ein bisschen Zeit und Ruhe gewinnen können. Da der Friedhof
bei Nacht den meisten Menschen eher Angst einjagt, war es unwahrscheinlich,
hier gesucht zu werden. Martin fand auch im Dunkeln rasch das Grab seiner Eltern. Hier lagen sie,
Seite an Seite, zusammen in Ruhe und Stille, wie auch in ihrem Leben. Die
Mutter war vor drei Jahren zuerst gestorben, sie war in kurzer Zeit immer
magerer und schwächer geworden. Es ist ihnen allen erst viel zu spät
aufgefallen, diese Veränderung, doch die Mutter wollte, wie früher schon so oft,
ihrer Umwelt keine Belastung sein, sie hatte über ihre Beschwerden geschwiegen.
Bis sie etwas merkten, war es schon zu spät. Manche sagten, es war Krebs. Der
Vater ist seiner Frau ein Dreivierteljahr später gefolgt, eigentlich ist er ihr
nachgestorben, auch wenn ein Unfall seinen Tod
verursachte. Er hatte den Tod seiner Frau nie überwunden, war zwar für seinen
Sohn auf seine wortlose Art immer da, doch der Schmerz über den Verlust ließ
ihn unvorsichtig und achtlos werden, auch bei der Arbeit. Als die Mauer der Scheune
während des Abrisses einzustürzen begann, war er nicht schnell genug. Er starb
nicht sofort, man befreite ihn aus den Trümmern. Martin konnte noch seine Hand
halten, und in den schwächer werdenden Augen des Vaters erkannte er neben der
Trauer auch die Bitte, der Sohn möge ihm verzeihen, weil er nicht stark genug
gewesen war. Martin hatte es verstanden. Seitdem war er allein und zugleich auch
nicht allein. Sein Onkel hatte ihn aufgenommen, er und seine Familie kümmerten
sich um ihn, doch alles war nicht so wie früher. Sie waren gut zu Martin, oder
wollten es zumindest sein, aber richtig froh wurde der Junge bei der neuen
Familie nicht. Ob sie daran schuld waren oder ob es an Martin lag, wer weiß –
vielleicht lag es an beiden Seiten. Doch das war in diesem Augenblick Martin so ziemlich egal. Da saß er nun,
in dieser Märznacht, allein auf dem Friedhof. Wohin sollte er nun rennen? Wo
sich verstecken? Was sollte mit ihm werden? Vielleicht sollte er zum Pilzstein,
sich dort verstecken? Oder hinaus in Richtung Werischwar,
wo die Reste des Römerhauses und der römischen Steine zu finden waren, von
denen sein Lehrer, Pista bácsi,
im Unterricht mit so viel Begeisterung erzählt hatte? Viel häufiger und viel
länger erzählt, als dass es für die Schüler am Ende noch interessant gewesen
wäre… Doch er hatte Pista bácsi
gemocht, auch wenn und vielleicht sogar weil dieser so viel und gerne über das Pilischgebirge, die hiesigen Ortschaften und ihre
Geschichte erzählte, obwohl er gar nicht aus Tschawa
stammte. Und eigentlich, das wusste der Junge, hatte Pista
bácsi die Kinder gern gehabt, der Lehrer schien zu
wissen: für beinahe alle Kinder war das Klassenzimmer einer der Orte, an dem
sie sich ausruhen konnten, bevor sie daheim wieder bei der Arbeit mit anpacken
mussten. Ja, zu Pista
bácsi hätte er jetzt gehen können. Aber Pista bácsi war nicht mehr. Auch Pista bácsi war tot. Zwei
Schimmel hatten den Leichenwagen beim Begräbnis vergangene Woche gezogen, doch
die alten Frauen hatten auch jetzt noch, nach seinem Tod, sich ihre Münder über
ihn zerrissen, zwei Rappen hätten den Wagen ziehen müssen, hieß es, er sei doch
verheiratet gewesen, auch wenn er nie über seine Frau gesprochen hatte. Doch da
gebe es sogar eine Tochter, so tratschten sie, ja-ja,
so einer war der Herr Lehrer Csizmadia gewesen, und
die schiefen Blicke, die sie einander zuwarfen, und die absichtlich
abgebrochenen Sätze waren bösartig. Und jetzt saßen die alten Frauen
zusammen mit den anderen eingepfercht in den Waggons am Bahnhof und warteten
ergeben auf ihr Schicksal. Darauf, dass der Zug seine Fahrt nach Deutschland
antrete. Auch Martin war mit der Familie
seines Onkels gegen Mittag auf dem alten Fuhrwerk zum Bahnhof mitgefahren,
nachdem das Haus von der Aussiedlungskommission kontrolliert und versiegelt
worden war. Sie waren zu fünft gekommen, zwei von ihnen waren sehr
unfreundlich, sie sprachen zu ihnen, als wären sie Diebe oder Verbrecher.
Martins Onkel ließ dies geschehen, er wollte keinen Streit und er wollte sie
nicht dazu reizen, die Kisten, in denen ihre Habseligkeiten zur Mitnahme
verstaut worden waren, genauer zu kontrollieren. Zwar hatte er den doppelten
Boden, unter dem er dann sein Werkzeug versteckte, sehr umsichtig hergerichtet,
doch wer weiß, ob eine genaue Prüfung nicht die verbotene Fracht entdeckt
hätte? Einer der Unfreundlichen versiegelte die Haustür, während die Kisten aufs
Fuhrwerk gehoben wurden – wobei der junge Mann aus der Kommission, dem die
gesamte Prozedur deutlich erkennbar unangenehm war und der auch niemandem in
die Augen zu sehen wagte, mithalf. Dann ging es zum Bahnhof, zu dem Waggon, dessen Nummer der Onkel im Rathaus
Tage zuvor abgeholt hatte. Da stand der Zug, 36
Waggons, 31 davon für die Tschawaer, jeweils für etwa
30 von ihnen ein Waggon. Angst, Schrecken, Bangen und die
Hoffnung, im letzten Augenblick würde sich noch alles zum Guten wenden, man
werde nicht wegtransportiert werden, lagen spürbar in der Luft. Doch nichts geschah.
Die Stunden vergingen und es hieß, der Zug würde erst losfahren, wenn die
amerikanische Begleitmannschaft angekommen sei. Martin saß in der Tür des Waggons, seine Beine ließ er herunterhängen. „Die
aus Ungarn nach ihr Mutterland zurückkehrenden Deutschen werden in eine Zone
Deutschlands unter amerikanischer Besetzung übersiedelt“, stand in der
Kundmachung, die ihr Schicksal zu besiegeln schien. Amerikanische Besetzung?
Amerikanische Begleitmannschaft? Was sollte Martin mit Amerika? Sein Vater war
von dort zurückgekommen, er hatte von Amerika nichts mehr wissen wollen, warum
sollte es für Martin nun anders sein? Während zumeist die Frauen die Waggons mit Blumen und Tannengrün zu
verschönern versuchten und die ersten Heiligenbilder, die früher im gefeierten
Zimmer und in der Schlafstube gehangen hatten, an den Wagen befestigt wurden,
beobachtete Martin die Bewachung des Zuges. Die Wächter wurden, je mehr Zeit
verstrichen war, immer nachlässiger. Der Zug war zwar umstellt, doch die Kette
der Wächter wies langsam deutliche Lücken auf. Sie schienen sich an die
Situation gewöhnt zu haben und da es keinerlei nennenswerte Gegenwehr gegeben
hatte, rechneten sie offensichtlich auch nicht mit Renitenz. Als es Dunkel zu
werden begann, nutzte Martin die Gelegenheit. Er war zuvor schon mehrfach bis
an die Wachen heranspaziert, war die ersten Male mit rüden Worten zum Waggon
zurückgeschickt worden, doch je mehr sich die Wachen langweilten und
miteinander zu plaudern begannen, je mehr Zeit verging und je mehr Menschen aus
den Waggons sich die Beine vor den Wagen zu vertreten begannen, desto
unübersichtlicher wurde die Situation. Martin ließ sich etwas zu essen geben,
steckte sich drei Äpfel ein und wartete. Als die Umrisse der Dinge in der
Abenddämmerung zu verschwimmen begannen fasste er sich ein Herz und lief durch
die Kette der Wachen hindurch. Er hörte aufgebrachte Männerstimmen, wüste
Beschimpfungen und Drohungen, die ihm galten, er hörte die schweren Schritte
hinter sich, ja, er glaubte sogar einen Schuss gehört zu haben, ohne ganz
sicher zu sein, dass es einer gewesen war und ihm gegolten haben mochte, er
hörte viel, jedoch hörte er nicht hin, sondern lief, wie er vielleicht noch in
seinem ganzen bisherigen Leben nicht gelaufen war. So war er zunächst entkommen. Am Grab seiner Eltern verbrachte er nun die Nacht. Es war schon spät,
vielleicht war es gerade Mitternacht und Geisterstunde, als er in der
klirrenden Kälte meinte, den Zug vom Bahnhof losfahren zu hören. Kurz darauf
fiel er in einen Schlaf, der ihn für lange Stunden erlöste. Die nächsten beiden Tage, den Samstag und den Sonntag, verbrachte er
versteckt auf dem Friedhof. Am Samstag hatte er schon bis zum Mittag alles
aufgegessen, doch er traute sich nicht, den Friedhof zu verlassen. Die meiste
Zeit schlief er, doch am Sonntag, drei Wochen vor Ostern, begann der Hunger
immer schlimmer zu werden. Er wagte sich aber nicht hinaus aus dem Friedhof,
bleiern fiel er abends in den Schlaf. Am Montagmorgen musste er aber fort, das wusste er. Nachdem er erwacht war,
verabschiedete er sich von den Eltern, schwor ihnen, regelmäßig wiederzukommen. Dann wollte er hinaus aus dem Friedhof, ahnend, dass es dauern könnte, bis
er das nächste Mal wieder hier sein würde. „Pista bácsi“, fuhr es
ihm durch den Kopf. Von ihm wollte er sich auch noch verabschieden, bevor er
ging, das Grab war nicht weit. Er sah die Frau, die nicht alt, für seine Kinderaugen aber auch nicht jung
zu sein schien, schon von weitem. Sie kniete am Grab von Pista
bácsi. Martin kam näher. Die Frau blickte zu ihm auf und die Augen von Pista bácsi sahen ihn traurig an. „Wie heißt du?“ fragte sie auf Deutsch mit starkem ungarischen Akzent. „Martin.“ „Schwarzenberg?“ „Ja. Woher…?“ stockte der Junge verwundert. „Mein Vater hatte nur einen einzigen Martin unterrichtet, den er besonders
gern hatte. Und ich glaube, dass dieser Martin auch meinen Vater gemocht hat. Dieser
Martin heißt Martin Schwarzenberg.“, sie lächelte leise. „Und dass Du Schwabe
bist, dass sehe ich an Deiner Kleidung.“, sie blickte auf den Riss an seinem
Oberschenkel „Und an ihrem Zustand.“ Sie stand langsam auf, während Martin nach Worten suchte. „Und an Deinem Zustand sehe ich es auch.“, fuhr sie fort, trat an
Martin heran und fuhr ihm sanft durch das Haar. „Du bist allein, nicht wahr?
Ich habe Dich schon als ich hier am Friedhof angekommen bin, liegen
und schlafen gesehen. Am Grab der Schwarzenbergs.“ Martin schwieg. „Du bist doch nicht einfach von Zuhause ausgerissen… Jeder weiß, was Euch
zugefügt worden ist und die Anständigen schämen sich dafür. Mein Vater hat es
jedenfalls getan.“ Der Junge blickte sie unschlüssig an. „Kannst Du irgendwohin?“ Martin schüttelte den Kopf. „Sind die Deinen im Zug gewesen?“ Eine erste Träne erschien in Martins Augen. Die Frau streckte ihm ihre Hand hin und sagte: „Komm. Ich habe auch niemanden mehr.“ Martin ergriff die Hand nicht. Er zuckte mit den Schultern, doch seine
Kehle war wie zugeschnürt. „Hier kannst Du nicht bleiben. Ich habe eine Stelle in Pest, da geh´ ich heute
das erste Mal hin. Niemand kennt mich dort, ich nehm´
Dich mit als meinen Sohn. Als István. István Csizmadia.“ Martin zögerte. „Wenn es Dir nicht gefällt und Du weggehen willst, kann ich Dich sowieso
nicht aufhalten.“ Der Junge blickte sich verunsichert um. „Du wärst, wir wären in der Nähe von Tschawa.
Wir könnten unsere Eltern immer besuchen, wenn auch zuerst noch mit Vorsicht,
damit man Dich nicht wieder erkennt. Aber Du wirst ja wachsen und Dich
verändern. Vielleicht ist dieser Spuk aber auch bald vorbei.“ „Ich… ich…“, mehr brachte Martin nicht heraus. „Schau, Martin. Ich gehe jetzt. Es ist noch früh, kaum jemand wird uns jetzt
sehen. Ich wäre froh, wenn Du mitkämst. Wenn nicht, dann verrate ich Dich auch
niemandem, habe keine Angst.“, langsam griff sie nach ihrem Bündel, schulterte
es und strich mit der freien Hand durch Martins Haar. Dann ging sie. Martin sah ihr nach. Ihre Gestalt wurde kleiner und kleiner. Dann war sie schon am Tor. Er lief ihr nach. |
|
Kerekes Gábor, Budapest | 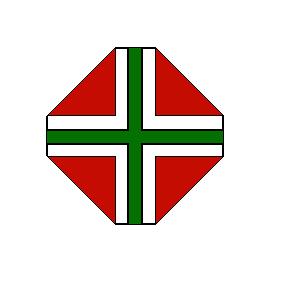 |